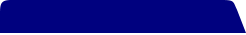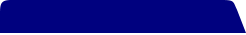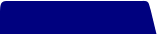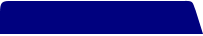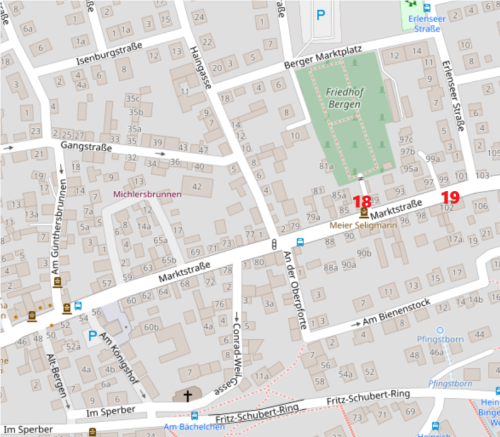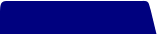
Rundgang
Initiative Stolpersteine Bergen-Enkheim
Frankfurt am Main
ROSA HIRSCH, geb. Grünebaum
Marktstraße 102
BIOGRAPHIE
Rosa Grünebaum wurde am 10. Dezember 1892 als
Tochter des Ölhändlers Adolf Grünebaum und dessen
Frau Henriette, geb. Kahn, in der Marktstraße 102 in
Bergen geboren.
Sie besuchte zunächst die Volksschule in Bergen und ging
dann auf das Philantropin in Frankfurt am Main. Im
Anschluss hatte sie eine Ausbildung als staatlich geprüfte
Krankenschwester, als die sie bis zu ihrer Heirat im Mai
1919 tätig war.
Rosas Mann, der am 4. Juli 1888 geborene Friedrich
Nathan Hirsch, war Pferdehändler und hatte in der
Marktstraße 102 in Bergen ein Geschäft, das im
„Verzeichnis der in der Gemeinde Bergen-Enkheim
bestehenden jüdischen Gewerbe-Betriebe“ vom 12.12.1938
als „Vertretung von chemisch-wissenschaftlichen
Apparaten“ aufgeführt ist. Es handelte sich um einen
Großhandel mit medizinischen und
Laboratoriumsartikeln, in dem seine Frau Rosa tätig war, da sie als Krankenschwester vor allem im
Laborbereich über wertvolle medizinische Fachkenntnisse verfügte. Die Familie musste zur Betreuung der
beiden Kinder, Ingeborg, geboren
am 11. August 1920, und deren
Bruder Adolf, eine Haushaltshilfe
beschäftigen, da die Mutter als
Angestellte ihres Mannes
ganztägig berufstätig war. Die
Nachbarin Ilse Stein gab in dem
Entschädigungsverfahren der
Tochter eine eidesstattliche
Erklärung ab, die bestätigte,
dass Rosa den ganzen Tag im
Geschäft ihres Ehemannes
arbeitete und deswegen ein
„Hausmädchen“ brauchte.
Adolf, der Sohn der Hirschs,
hat laut der im Hessischen
Hauptstaatsarchiv vorliegenden
Entschädigungsakte von
Ingeborg Adelsberger zunächst Inge und Eddíe (Adolf) Hirsch mit Mutter Rosa Hirsch | Foto: privat
in New York und anschließend
in Gezer, Israel, gelebt, wo er am 10. Juni 1948 verstorben ist.
Die Familie Hirsch wurde in der Pogromnacht vom 10.11.1938 Opfer von Vandalismus und Zerstörung;
Zeitzeugen berichteten, dass Teile des Büromobiliars aus dem Fenster geworfen wurden und im Hof des
Anwesens Marktstraße 102 Feuer gelegt wurde. Die Familie zeigte sich in der Folgezeit selten in der
Öffentlichkeit. Nachbarn brachten ihnen heimlich Essen, das sie ihnen über den Zaun reichten. Vom 7.
Juli 1939 bis zum 12. Juni 1942 war die Familie dann beim 8. Polizeirevier in Frankfurt am Main gemeldet.
Sie lebte dort in der Weberstraße 7. Der Umzug in die Weberstraße ist unter dem Datum 4. Juli 1939 bei
Pfarrer Wessendorft in seiner Publikation „Unsere letzen jüdischen Mitbürger“ aus dem Jahr 1960, zitiert bei
H. Ulshöfer, a.a.O., S. 40, als Zwangsumzug erwähnt.
Über die Deportation von Rosa Hirsch sind keine Details bekannt. Sie wurde vermutlich mit ihrem Mann
1942 in ein Konzentrations- oder Vernichtungslager verschleppt, wo sie ums Leben kam. Pfarrer
Wessendorft berichtet in einem Nachtrag zu seiner o. g. Publikation von 1961, dass Fritz Hirsch von
Frankfurt aus mit einem Sammeltransport deportiert worden sei (p. 16)
Ingeborg Adelsberger wurde am 13.3.1958 aufgrund des „Schadens ihrer Mutter an beruflichem und
wirtschaftlichem Fortkommen“ für den Zeitraum von 1.9.1939 bis 8.5.1945 ein Betrag von 6.450 DM
zuerkannt, der sich aus 45 Monaten à 150 DM errechnete.
Das Todesdatum 8.5.1945 wurde für die Opfer des NS-Verfolgung festgesetzt, deren
Deportationsdatum nicht genau ermittelt werden konnte.
Die Tochter bekam zudem laut Bescheid der Entschädigungsbehörde am 23.7.1963 wegen
„verfolgungsbedingter“ Auswanderung in die USA eine Entschädigung von 560 DM zuerkannt. Sie war
1939 nach England und von dort 1947 in die Vereinigten Staaten ausgewandert, wofür sie erst nach dem
„Zwischenaufenthalt“ in England ein Einreisevisum bekam.
Quelle: Unsere Recherche beruht auf dem Auszug aus der Datenbank des Jüdischen Museums, der
Veröffentlichung von Helmut Ulshöfer, Jüdische Gemeinde Bergen-Enkheim, 1933-1942, Frankfurt 1988,
und der Entschädigungsakte der Tochter von Rosa und Friedrich Nathan Hirsch, Ingeborg Alelsberger,
(Abteilung 518 Nr. 16015) im Hessischen Haupt-staatsarchiv in Wiesbaden.
> Zurück zum Rundgang
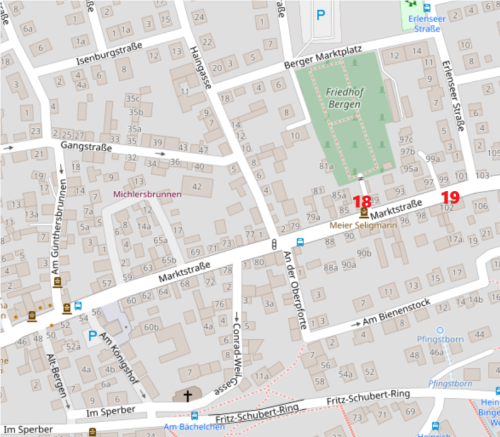



Eddie (Adolf) Hirsch
Foto: privat